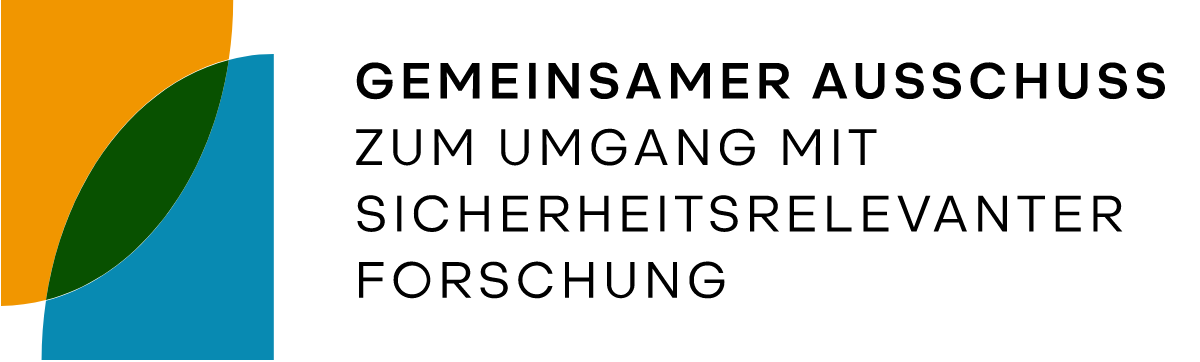Am 31. Mai 2021 fand die Online-Veranstaltung des Gemeinsamen Ausschusses zum Umgang mit sicherheitsrelevanter Forschung von DFG und Leopoldina in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh) statt, die Nutzen und Risikopotentiale chemischer Forschung diskutieren wollte.
Nach der Vorstellung der Aufgaben und Ziele des Gemeinsamen Ausschusses durch dessen Vorsitzende Britta Siegmund und Thomas Lengauer erinnerte der Geschäftsführer der GDCh Wolfram Koch an die wechselhafte Geschichte der Chemieforschung und deren Missbrauchsmöglichkeiten, beispielsweise beim Haber-Bosch-Verfahren, das einerseits geholfen hat, durch Düngerproduktion die weltweite Ernährung zu sichern, andererseits jedoch für die verheerenden Folgen des Einsatzes von Explosivstoffen im Ersten Weltkrieg verantwortlich war.
Matthias Epple von der Universität Duisburg-Essen stellte in seinem Vortrag die Chancen und Risiken von Nanomaterialien vor. Ein wichtiges Anwendungsfeld sei unter anderem die Nanomedizin, bei der Nanopartikel beispielsweise zur Tumorbekämpfung injiziert würden. Toxine fänden mithilfe dieser Anwendung Tumore und zerstörten diese idealerweise. Zellen könnten Nanopartikel aufnehmen, unter anderem Lipid-Nanopartikel, die z.B. mRNA-Impfstoffe gegen SARS-CoV-2 enthalten. Auch weitere Nanopartikel seien längst in unserem Alltag angekommen, etwa in Zahnpasta und Sonnencreme. Die Risiken der Einlagerung von Nanopartikeln in Zellen seien von den jeweiligen Subtanzen abhängig. Zudem müsse in der Debatte betont werden, dass sich die Abwesenheit eines Risikos generell wissenschaftlich nicht nachweisen ließe. Ein Zuhörer ergänzte, dass die Diskussion in Bezug auf Nanopartikel unter einem generellen Missverständnis leide. Es spiele mitunter keine Rolle, ob schädliche Partikel aufgrund ihrer Größe unter die Definition von Nanopartikeln fielen oder nicht.
Der Referent Clemens Walther von der Leibniz-Universität Hannover stellte die auf einem Jugendbuch von 1956 beruhende Frage „Ist das Atom noch unser Freund?“ und thematisierte damit den Geburtsfehler der Radiochemie, nämlich die Herstellung und den Einsatz von Atombomben. Die medizinische Anwendung der Radiochemie, wie der Einsatz von Radium zur Krebsbehandlung, zeige dennoch einen großen Nutzen und die industrielle Anwendung der Radioaktivität bei Tracern, Dicken- oder Dichtemessung sei mittlerweile allgegenwärtig. In der Forschung werde die Radiochemie in der Radioökologie oder in der Nuklearen Forensik angewandt. In der zivilen Forschung herrschten eine starke Regulierung und Kontrolle. Hauptsächlich würden Missbrauchspotentiale in der Exportkontrolle thematisiert, denn auch Grundlagenforschung könne unabsichtlich zur Herstellung von Massenvernichtungswaffen beitragen. Walther betonte, dass Forschende wenig Einfluss auf die spätere Verwendung ihrer Forschungsergebnisse hätten und zugleich ein erheblicher Publikationsdruck bestehe. Ein Diskutant hob hervor, dass Wissenschaftler nicht alleine Technikfolgenabschätzung betreiben könnten, sondern dafür Gruppen von Fachleuten notwendig seien. Auf die Frage nach Begleitforschung zur Radiochemie sagte Herr Walther, dass eine enge ethische Begleitung in der anwendungsbezogenen Forschung üblich sei. Forschung zur Gefahrenabwehr unterliege teilweise der Geheimhaltung.
Der unabhängige Berater Ralf Trapp verwies in seinem Vortrag am Beispiel des Handels mit Industriechemikalien darauf, dass Giftstoffe in Kriegen schon im Altertum verwendet wurden. Wenn man über die Verantwortung der Wissenschaft nachdenke, müsse man historische Komponenten in den Blick nehmen. An dieser Stelle verwies er auf Fritz Haber, der im ersten Weltkrieg auch als Berater für chemische Waffen agierte. Das Chemiewaffenprogramm in Syrien sei in den 1970er Jahren entwickelt worden – unterstützt durch den Iran und die Sowjetunion. 2013 sei Syrien zwar dem Chemiewaffenabkommen beigetreten, aber während der ersten Überprüfung habe es bereits Hinweise auf den Einsatz von Chemiewaffen in Syrien gegeben. Deutschland habe von 2002 bis 2006 Vorprodukte nach Syrien geliefert. Nach 2018 habe es weitere Lieferungen aus Deutschland, Brüssel und der Schweiz mit Ausgangsstoffen gegeben, die exportkontrollrechtlich zunächst als unbedenklich eingestuft wurden. Dies zeige, dass der rechtliche Ansatz ausgeweitet werden müsse, um das Chemiewaffenübereinkommen (CWÜ) und ihr Verifikationssystems zu stärken. Nicht nur im Bereich der Listenmaterialien, sondern auch darüber hinaus solle der Export von „Wissen“ Beachtung finden. Zugleich gelte es, die Industrie mit einer stärkeren Selbstkontrolle und Sensibilisierung auszustatten. Herr Trapp erläuterte, dass gerade an der Schnittstelle zwischen Chemie und Biologie Entwicklungen stattfinden würden, die auch bei einem staatlichen Chemiewaffenprogramm missbraucht werden könnten. Forschende hätten kaum Bewusstsein für Missbrauchspotentiale und es seien dahingehende Schulungen notwendig. Herr Kraus fragte, ob es überhaupt möglich sei, Missbrauch zu verhindern auch bei weniger toxischen Stoffen. Händler und Produzenten müssten nach Meinung von Herrn Trapp stärker deren Kunden oder weitere potentielle Nutzende ihrer Chemikalien in den Blick nehmen.
Una Jakob von der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung erläuterte in ihrem Vortrag zu den Auswirkungen des Chemiewaffenübereinkommens zunächst die Rahmenbedingungen des CWÜ. Dieses sei 1992 nach etwa 20-jähriger Verhandlungszeit beschlossen worden und sei seit 1997 in Kraft. Nichtunterzeichner seien nur Ägypten, Israel, Nordkorea und der Südsudan. Das CWÜ umfasse auch Mechanismen der Verifikation und Sanktion und sei aktuell das erfolgreichste Abrüstungsabkommen. Es werde fortwährend angepasst, unter anderem nach dem Vorfall der Vergiftung eines russischen Dissidenten mit Nowitschok. Es betreffe nur Staaten, jedoch keine nicht-staatlichen Akteure. Aus dem CWÜ ergäben sich besondere Herausforderungen für die Wissenschaft. So seien Kooperation von Industrie und Wissenschaft weiterhin notwendig. Zudem gebe es Dispute über die Auslegung des CWÜ, beispielsweise über nicht tödliche Chemiewaffen, die das Nervensystem angriffen. Wissenschaftliche Expertise solle die politische Diskussionen versachlichen. Neue Technologien und die Überschneidungen von Forschungsfeldern bürgten neue Missbrauchspotentiale, über die weitere Aufklärung erfolgen muss. Publikationen und Informationsaustausch seien für die freie Forschung wichtig, aber trotzdem sollte möglicher Missbrauch stets mitgedacht werden.
Julia Dietrich von der FU Berlin stellte Herausforderungen für die Bewusstseinsbildung zu Forschungsrisiken in Studiengängen der Chemie vor. Sie präsentierte ein Projekt, das die Vermittlung ethischer Aspekte in naturwissenschaftlichen Studiengängen untersuchte. Nur ca. 6% der Leistungspunkte behandelten ethische Aspekte – und das meist nur im Wahlpflichtmodul. 25 von 31 naturwissenschaftlichen Studiengängen wiesen laut Erhebung gar kein Ethikangebot auf. Nur in 2 von 31 Studiengängen hätte es Pflichtanteile über Ethik gegeben. In Medizinstudiengängen und in der Biologie hingegen sei die Ethik bereits seit Jahren fest verankert. Die Integration der Ethik in der Lehre erführe nur mangelnde Unterstützung durch die Leitungsebene. Dietrich plädierte für eine fächerübergreifende ethische Grundbildung und habe eine Lernplattform zu Genome Editing am Menschen entwickelt, die sich auch auf andere Themen und Wissenschaftsbereiche übertragen ließe. Wissenschaft und Ethik stünden sich nicht entgegen, sondern sollten immer als Teil voneinander betrachtet werden. Die Leitungsebene solle entsprechende Verbindlichkeiten schaffen – unter anderem mit Tagungen, Vernetzung und hinreichend ausgestatteten Stellenprofilen. Größere Lernplattformen und ein Zertifikatssystem könnten dabei hilfreich sein.
Hans-Georg Weinig von der GDCh stellte die Entwicklung der Hager Ethikleitlinien vor. Sie entstanden im Zusammenhang mit dem 100. Jahrestag des ersten massiven Chemiewaffenangriffs in Ypern. Zur Entwicklung der Leitlinien habe man zunächst eine Clusteranalyse von weltweit vorhandenen Ethikkodizes für Chemieforschung durchgeführt und sich auf die wichtigsten Kernelemente verständigt. Zugleich sei die Implementierung der fertiggestellten Ethikleitlinien wichtig. Dafür seien beispielsweise Selbstlernmodule zur Verfügung gestellt worden und es fänden entsprechende Beratungen zur Lehre und zur Verbreitung der Leitlinien statt. Um die Implementierung der Leitlinienweiter zu stärken, sollten sie in die Curricula der Studiengänge Einzug finden.
In der anschließenden Diskussion wurde bemerkt, dass ethische Fragen möglicherweise für Studenten wenig griffig seien und es entbrannte eine Diskussion darüber, ob es sinnvoll sei, bereits in der Schule wissenschaftsethische Fragestellungen aufzuwerfen oder ob man dies erst im Studium z.B. ab dem Masterstudium angehen solle. Felicitas Krämer erwähnte, dass in den gesamten Ingenieursstudiengängen in den Niederlanden bereits entsprechende Pflichtmodule etabliert wurden. Ein Zuhörer bemerkte, dass es ohne zusätzliches Personal schwierig sei, diese Ansprüche umzusetzen. Zudem sei die Zeit zur Vermittlung von fachlichen Inhalten in den Studiengängen begrenzt. Herr Lengauer gab zu bedenken, dass Ethik nicht zwingend in separaten Kursen behandelt werden müsse, sondern ethische Inhalte in jeder Lehrveranstaltung implementiert werden könnten.